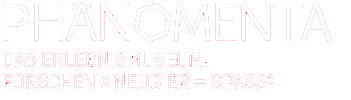Resultate und Projektergebnisse aus den KUMASTA-Workshops in der PHÄNOMENTA
Ab 8 Jahren: In diesem Workshop erstellen die Teilnehmer, unterstützt von den Mitarbeitern der PHÄNOMENTA ein Drehbuch für ein Erklärvideo. Die Kinder wählen ein Exponat aus der Ausstellung aus und erklären das Phänomen als „Erklär-Bär“ vor der Kamera. Sie erlernen dabei die Grundlagen der Filmproduktion und entdecken, wie sie wissenschaftliche Themen kreativ und verständlich präsentieren können.
Der Hörnerblitzableiter
Als ergänzende Information soll hier angeführt werden, dass die Erklärvideos keinen Anspruch auf wissenschaftliche Richtigkeit und Genauigkeit erheben. Zum Abgleich daher die wissenschaftliche Erklärung des Exponates:
Der Hörnerblitzableiter ist ein besonderer Blitzableiter. Er ist nicht mit der Erde verbunden, sondern wird bei Hochspannungs- und Oberleitungen eingesetzt. Dort schützt er die Leitungen, indem er zu hohe Spannungen über einen kurzzeitigen Lichtbogen ableitet.
Mit einem Transformator wird eine sehr hohe Spannung von über 10.000 Volt an die beiden Metallhörner angelegt. Normalerweise verhindert die Luft zwischen den Hörnern, dass ein Funke überspringt.
Fährt jedoch ein Metallstift zwischen den Hörnern nach oben, verkleinert sich der Abstand. Die Luft kann den Strom nicht mehr halten und ein Lichtbogen entsteht. Dabei wird die Luft leitfähig und beginnt zu leuchten.
Wenn der Metallstift wieder verschwindet, bleibt der Lichtbogen bestehen und wandert langsam nach oben. Das liegt daran, dass die Luft im Lichtbogen sehr heiß wird und nach oben steigt – ähnlich wie bei einem Heißluftballon. Gleichzeitig wirkt auch das elektromagnetische Feld zwischen den Hörnern. Irgendwann wird der Lichtbogen zu lang und reißt ab.
Solche kleinen Lichtblitze kann man auch zu Hause sehen: Zum Beispiel, wenn man im Dunkeln einen selbstklebenden Briefumschlag aufreißt. Zwischen den Klebeflächen entstehen winzige blaue Blitze.
Tornado in der Röhre
Als ergänzende Information soll hier angeführt werden, dass die Erklärvideos keinen Anspruch auf wissenschaftliche Richtigkeit und Genauigkeit erheben. Zum Abgleich daher die wissenschaftliche Erklärung des Exponates:
In einer Plexiglasröhre von etwa zwei Metern Höhe wird ein künstlicher Tornado erzeugt. Dazu blasen Düsen Luft von der Seite hinein, während ein Ventilator sie nach oben absaugt. So entsteht eine kreisende Luftbewegung. Feiner Nebel aus einer Nebelmaschine und Licht von oben und unten machen den Wirbel sichtbar. Besonders spannend: Mit einem Laserstrahl wird eine Ebene des Tornados beleuchtet. Dadurch erkennt man die Strömungen – ähnlich wie auf einer Wetterkarte.
Ein echter Tornado (auch „Windhose“ genannt) entsteht bei bestimmten Wetterlagen über dem Land. Wenn warme und kalte Luftmassen aufeinandertreffen, steigt Warmluft spiralförmig unter einer Gewitterwolke nach oben. Auf der Nordhalbkugel dreht sich dieser Wirbel meist gegen den Uhrzeigersinn. Weil die Luft sich dabei zusammenzieht, dreht sich der Tornado immer schneller – ähnlich wie ein Eiskunstläufer bei einer Pirouette. So entstehen Windgeschwindigkeiten von mehreren hundert Kilometern pro Stunde.
Sichtbar wird der Tornado, wenn Wasserdampf unter der Wolke den schlauchartigen Wirbel bildet, der bis zur Erde reicht. Dort kann er durch seine starke Sogwirkung große Schäden anrichten.
Große Wirbelstürme über dem Meer heißen je nach Region unterschiedlich: Hurrikan im Atlantik, Taifun in Asien und Zyklon im Indischen Ozean. Die Strömungsmuster in unserem künstlichen Tornado ähneln denen, die man bei Tiefdruckgebieten auf der Wetterkarte sieht.
Plasmakugel
Als ergänzende Information soll hier angeführt werden, dass die Erklärvideos keinen Anspruch auf wissenschaftliche Richtigkeit und Genauigkeit erheben. Zum Abgleich daher die wissenschaftliche Erklärung des Exponates:
In der Glaskugel zucken rote und blaue Lichtfäden, die wie kleine Blitze aussehen. Physikalisch betrachtet sind es tatsächlich Blitze, nur mit sehr viel weniger Energie. Besonders spannend wird es, wenn man die Kugel mit der Hand berührt: Dann bündeln sich die Lichtfäden zu hellen, kräftigen Strahlen, die direkt an den Fingern enden. Aber warum bekommt man dabei keinen Stromschlag?
Im Sockel der Plasmakugel sitzt ein Tesla-Transformator. Er erzeugt eine Wechselspannung von einigen tausend Volt zwischen dem kleinen Metallkern in der Mitte und der äußeren Glaskugel. Der Raum dazwischen ist mit Gasen (vor allem Argon) bei niedrigem Druck gefüllt.
Durch natürliche Strahlung werden einzelne Atome dieser Gase ionisiert – das heißt, Elektronen werden herausgeschlagen. Diese Elektronen werden vom elektrischen Feld beschleunigt und stoßen dabei weitere Elektronen frei. So entsteht eine Kettenreaktion, bei der ein Strom aus Elektronen ständig hin- und herschwingt.
Das Gas wird durch diese Vorgänge angeregt: Manche Atome geben ihre zusätzliche Energie als Licht ab. Deshalb leuchten die Fäden in verschiedenen Farben. Gleichzeitig erwärmt sich das Gas, die warme Luft steigt auf, und die Entladungsfäden bewegen sich ständig.
Wenn man die Kugel anfasst, verändert sich das elektrische Feld. Der eigene Körper wirkt dann wie ein Leiter, über den die Elektronen bevorzugt abfließen können. Alle Fäden sammeln sich in einem einzigen, dicken Strahl, der heller leuchtet und den Finger erreicht.
Gefährlich ist das nicht: Die Spannung wechselt so schnell ihre Richtung, dass der Strom nur über die Hautoberfläche fließt und nicht in den Körper eindringt (Skin-Effekt).
In Kooperation mit: